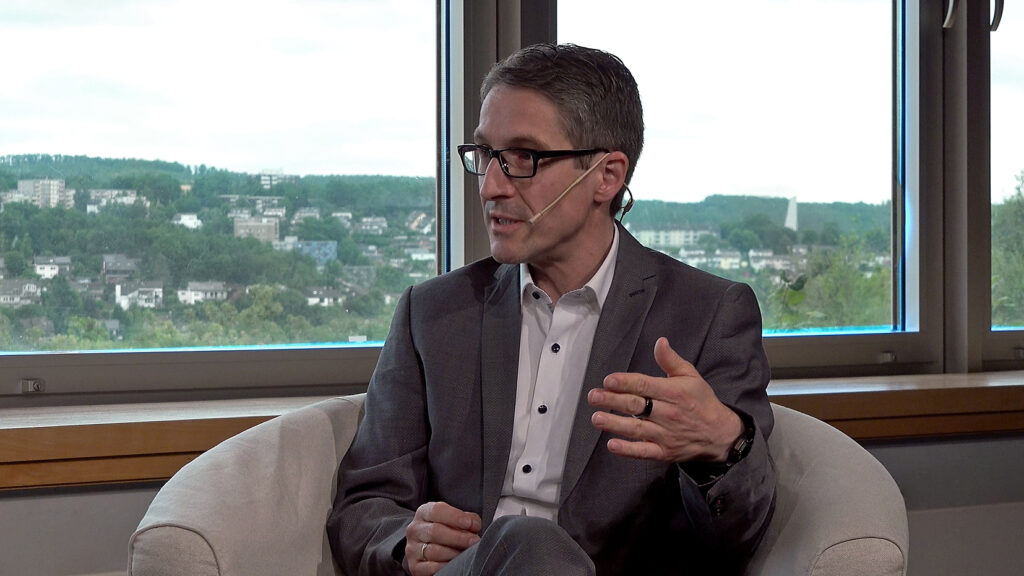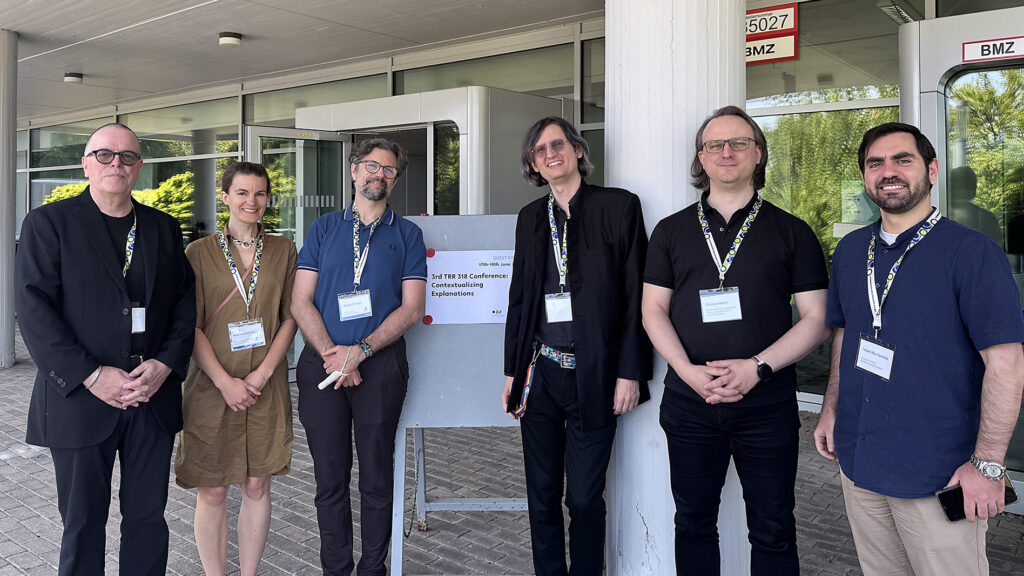Anlässlich des jährlich erscheinenden Berichts zu den Aktivitäten der Digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck (DMGD) haben Dr. Olaf Gaus, geschäftsführender Leiter der DMGD, und Stefan Hundt, langjähriger Projektbegleiter und strategischer Berater der DMGD, das vergangene Jahr resümiert und geben einen Ausblick auf die anstehenden Veränderungen im Bereich der Gesundheitsforschung an der Universität Siegen. Sie betonen, dass dem Wissenschafts- und Technologietransfer dabei eine zentrale Rolle zukommen sollte, da dies wichtige Chancen und Synergieeffekte für die Region eröffnen kann. Zugleich verweisen sie auf das Potenzial der DMGD-Modellregion, sich im Bereich der digitalen Gesundheit als Leuchtturmprojekt für ganz Nordrhein-Westfalen zu etablieren.
„Third Mission“ der Hochschulen wichtiger denn je für Innovationen der digitalen Gesundheitsversorgung
Im vorangegangenen Editorial des DMGD-Zwischenberichts war zu lesen: „Die Medizin ist weltweit auf dem Weg, sich zu einer ‚Datenmedizin‘ zu entwickeln.“ Nicht zuletzt das „Digital Health Innovation Forum 2025“ (DHIF) am Hasso-Plattner-Institut (HPI) im März dieses Jahres hat eindrucksvoll gezeigt, dass dieser Weg nicht nur in den internationalen Gesundheitswissenschaften konsequent weiterentwickelt wird, sondern dass, daran angelehnt, auch die Gesundheitsindustrie aller Branchen diese Forschung weltweit als Bassin für ihre Innovationen nutzt. Und Deutschland? Wir spielen nach wie vor im Konzert der „Großen“ eine eingeschränkte Rolle, weil wir – anders als die Vereinigten Staaten von Amerika oder das Vereinigte Königreich – die Möglichkeiten der „Third Mission“ nicht ausreichend berücksichtigen.
Die „Third Mission“, also der Wissenschafts- und Technologietransfer, ist nicht (mehr) ausschließlich eine Sache der Top Five oder Top Nine der technischen Universitäten in Deutschland. Die Austausche und Kooperationen mit deutschen, aber auch internationalen Wirtschaftsunternehmen, sind wichtiger denn je. Ein Beispiel aus der Sicht der DMGD: Das DHIF in Potsdam hat gezeigt, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Gesundheitswissenschaften in internationalen und interdisziplinären Teams daran forschen, wie etwa auf der Grundlage neuer Datenkonzepte unter Zuhilfenahme innovativer Methoden der Künstlichen Intelligenz neue Wege der frühzeitigen Erkennung und Behandlung von Krankheitsbildern erreicht werden können. Die darin erkennbaren Innovationen versprechen nicht nur neue und effektive Wege der Prävention von Erkrankungen, sondern vielmehr auch Chancen der Prädiktion, die frühzeitige gesundheitliche Interventionen, neue Therapieansätze und Kostensenkungsmodelle für die Kostenträger im Gesundheitswesen ermöglichen. Die branchennahen Wirtschaftsunternehmen sind sehr daran interessiert, möglichst frühzeitig in diese Entwicklungen einbezogen zu werden, – wir müssen solche Kooperationen nur intelligent planen im Rahmen einer „Third Mission“.
Die Universität Siegen stellt sich für die Bearbeitung des Themas „Gesundheitsforschung“ neu auf. An die Stelle der vormaligen Lebenswissenschaftlichen Fakultät (LWF) tritt nun eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung (ZWE), deren Konzept auch und besonders den Wissenschafts- und Technologietransfer in den Gesundheitswissenschaften mit einem Schwerpunkt „Digital Health“ berücksichtigt. Die Digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck (DMGD) wird in diesem Format aufgehen mit der Möglichkeit, interdisziplinäre Forschung, international ausgerichtet, weiter voranzutreiben – auch und gerade im Verbund mit Wirtschaftsunternehmen, um Innovationen frühzeitig in eine Anwendung zu überführen, denn eine Modellregion braucht Testbeds.
Ein solches Testbed ist seitens der Rektorin der Universität Siegen in Zusammenarbeit mit der DMGD mittlerweile in Form eines Projektantrages zum Aufbau einer „Digitalen Praxis“ als telemedizinisches Zentrum auf dem Campus der RWTH Aachen unter dem Titel „Gut versorgt in NRW“ 1 auf den Weg gebracht und an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) adressiert worden. Die Umsetzung dieses Vorhabens ist nicht auf die Forschungsseite beschränkt, sondern konzentriert sich unter Verwendung moderner technischer Implikationen auf digital unterstützte Versorgungspfade. Das dafür gebildete Projektkonsortium deckt die klinische, ambulante Medizin in NRW ebenso ab wie die klinische und ambulante Pflege, die Gesundheitsregionen unter Einbindung von Kreisen und Kommunen, aber auch Expert*innen im Bereich der Fort- und Weiterbildung – insbesondere für Laien in der Gesundheitsversorgung, da das Konzept der Datenmedizin auf Self-Care-Verfahren von Patientinnen und Patienten setzt.
Die wissenschaftspraktische Umsetzung innerhalb der DMGD lässt sich am jüngsten Projektbeispiel „Telemed@ATN“ in Kooperation mit der Hansestadt Attendorn im Kreis Olpe veranschaulichen.2 Die dort durchgeführte Studie zeigt, dass sowohl Gesundheitsexpert*innen wie auch Bürger*innen Chancen darin erkennen, die gesundheitliche Überwachungen von chronischen und vorübergehenden Erkrankungen durch digitale Anwendungen und Vitalzeichenerhebung im häuslichen Umfeld zu unterstützen. Dieses Konzept einer Digitalen Praxis wird von 65% der befragten Expert*innen als (eher) positiv bewertet. Auch die Realisierung eines Digitalen Praxiskonzeptes mithilfe eines Public Private Partnership-Ansatzes wird als ein möglicher Lösungsweg gesehen. Die dazu befragten Unternehmen vor Ort betonten an dieser Stelle vor allem den Stellenwert der Gesundheitssicherung ihrer Mitarbeitenden und den Zugewinn an Attraktivität für den Unternehmensstandort. Eine Herausforderung ist dabei vor allem ein stringent einzuhaltendes Datenschutzkonzept.
Die sich daraus ergebenden Implikationen für die Gesundheitsforschung wie auch für die Versorgungspraxis zeigen, dass durch die Einbeziehung verschiedener Instanzen, wie Ärzt*innen, Pflegekräfte, der Stadtverwaltung, Politik und Unternehmen ein vielschichtiges Bild auf Lösungsansätze von zu befürchtender gesundheitlicher Unterversorgung gezeichnet werden konnte. Der partizipative Ansatz gibt Bürger*innen dabei die Chance ihr Nahfeld – hier: die Hansestadt Attendorn – aktiv mitzugestalten und an Lösungsansätzen mitzuwirken. Durch diesen spezifischen Blick auf die Bedürfnisse der Menschen, die in einem solchen Mittelzentrum leben, lassen sich die Ergebnisse der Studie, also der positive Zuspruch zur Realisierung einer Digitalen Praxis unter Einbeziehung des PPP-Ansatzes, auch auf andere Mittelzentren übertragen und können Lösungsansätze zu einer flächendeckend guten Gesundheitsversorgung bieten und ländliche Räume stärken. So wird deutlich, dass eine moderne „Third Mission“ der Hochschulen wichtiger denn je für Innovationen der digitalen Gesundheitsversorgung ist.
1 Projektvorhaben „Gut versorgt in NRW – Innovative und digital unterstützte Gesundheitsversorgung“. Das Versorgungskonzept wurde im Feb. 2025 eingereicht bei Minister Karl-Josef Laumann, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
2 Publikation zu Telemed@ATN: „Digitale Praxis. Studie zur digitalen Transformation im Gesundheitswesen am Beispiel der Hansestadt Attendorn“ (Arbeitstitel; erscheint 2025/2026)
Das Editorial des DMGD-Berichts sowie eine Übersicht über die weiteren Inhalte ist auf unserer Download-Seite verfügbar. Den kompletten Bericht erhalten Sie bei Interesse auf Anfrage.