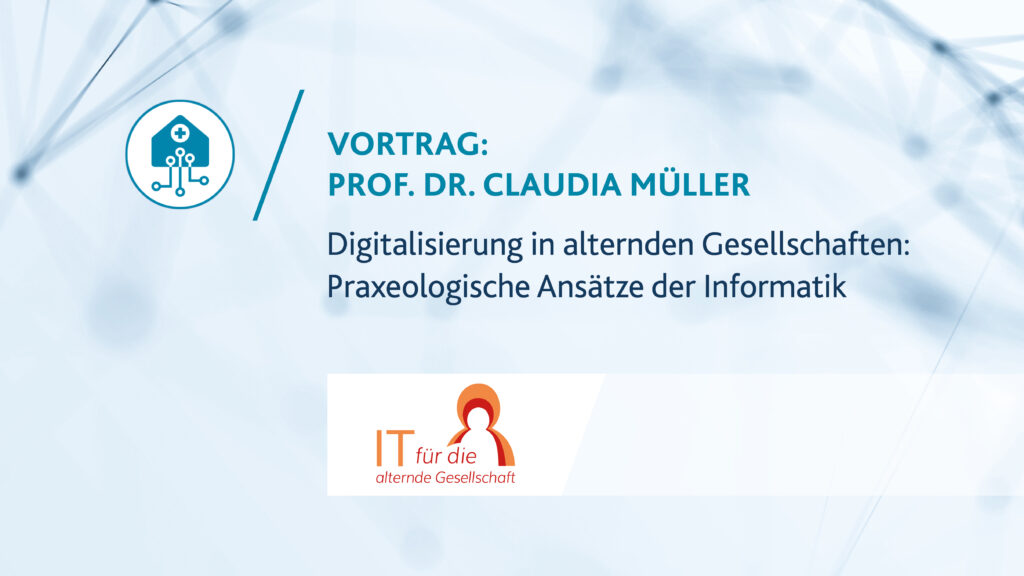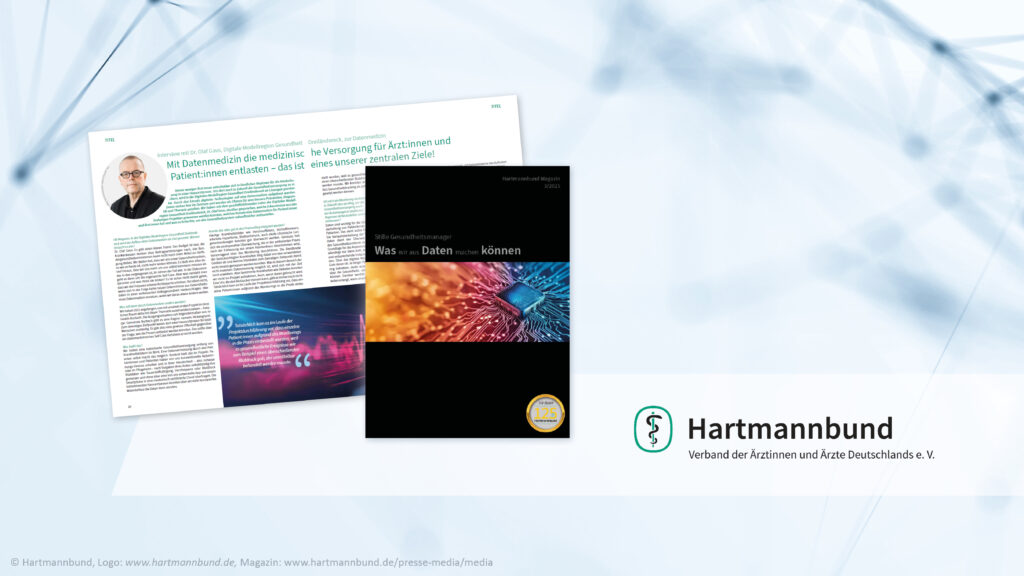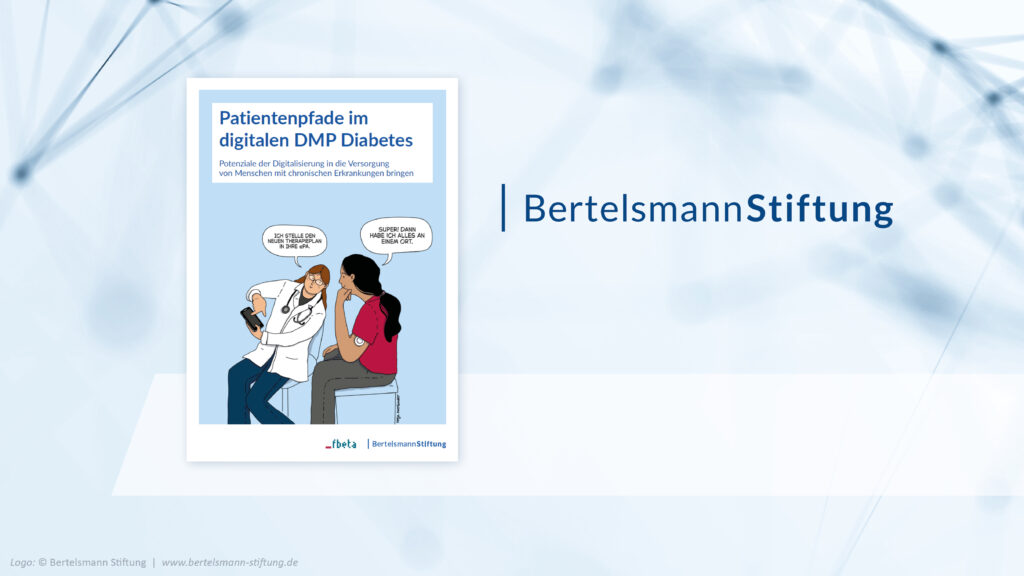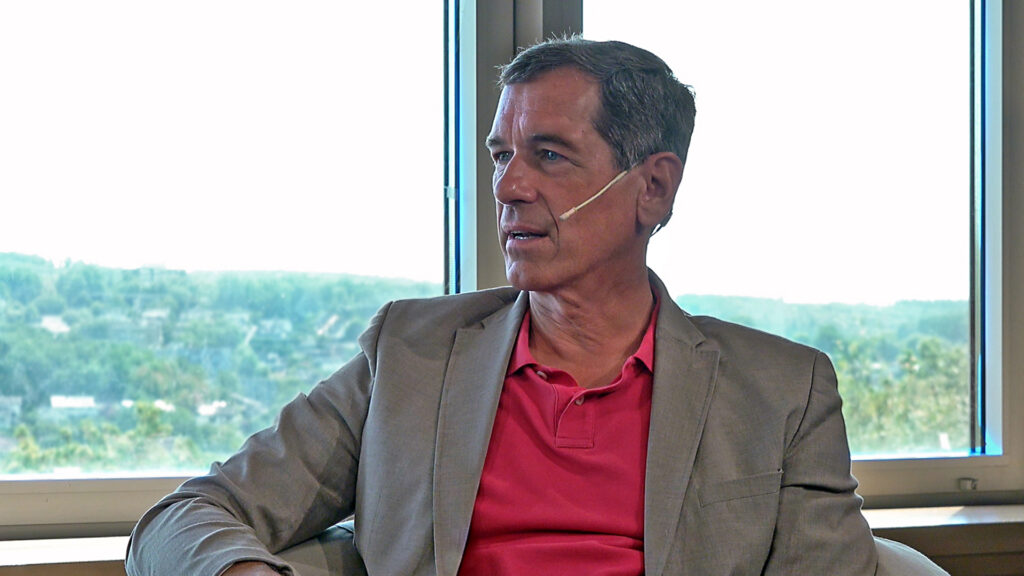Mubaris Nadeem, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen, gewährte am 21. Oktober Einblicke in sein Thema „Integration hybrider Wissensgraphmodelle zur Echtzeitentscheidungsunterstützung in der medizinischen Notfallversorgung“. Der digitale Vortrag wurde organisiert von der Forschungsgruppe „Digitale Praxis“ der Digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck (DMGD) an der Universität Siegen.
Als Wissenschaftlicher Mitarbeiter ist Mubaris Nadeem Mitglied der Arbeitsgruppe Medizinische Informatik und Graphbasierte Systeme (.MIGS) an der Universität Siegen. Zum vorgestellten Thema forschte der Doktorand im Rahmen seiner gleichnamigen Dissertation, die Prof. Dr.-Ing. habil Madjid Fathi, Lehrstuhlinhaber für Wissensbasierte Systeme und Wissensmanagement an der Fakultät IV der Universität Siegen, als Erstgutachter betreute.
„Ich freue mich ganz besonders über den Vortrag. Es ist eine zunehmend schwierigere Aufgabe, medizinische Daten in das digitale Zeitalter zu führen“, erklärte Dr. Christian Weber, der gemeinsam mit apl. Prof. Dr.-Ing Kai Hahn die Arbeitsgruppe .MIGS leitet. Die Notfallversorgung eigne sich als abgegrenztes medizinisches Gebiet gut als Untersuchungsgegenstand.
In seiner Präsentation spricht Mubaris Nadeem über die bestehende Wissensfragmentierung in der Medizin. Neben einer Vielzahl aktueller Forschungsergebnisse gibt es umfassendes Erfahrungswissen in der internationalen Ärzteschaft sowie große Datensätze medizinischer Vitalparameter. „Wir leben in einer Zeit, in der wir der Fülle an verfügbaren Daten kaum noch nachgehen können. Zusätzlich nimmt der Fachkräftemangel zu, während der Bedarf an medizinischen Behandlungen steigt“, so Nadeem. Um dem zu begegnen, gilt es komplexes verstreutes Wissen optimal zu vernetzen und auf kompakte relevante Einheiten zu reduzieren. Auf diese Weise können Entscheidungen auf fundierter Datenbasis schneller und patientenzentrierter getroffen werden. „Gerade im Bereich der Notfallversorgung kommt es auf den Zeitfaktor an“, betonte der Promovierende. Externe Wissensquellen können eine patientenindividuelle Behandlung fördern und die Integration von Vitaldaten hilft bei der Überwachung von Echtzeitveränderungen. Zusätzlich können aktuelle Forschungsergebnisse in die Evaluation einbezogen werden.
Mubaris Nadeem beschrieb einen Wissensgraph als strukturierte Darstellung von Fakten, bestehend aus Entitäten, Beziehungen und semantischen Beschreibungen. Das Handbuch für Standardarbeitsanweisungen und Behandlungspfade im Rettungsdienst ist in geeignete Entitäten aufgeteilt, um Wissensgraphmodelle darauf anzuwenden. Wenn mehrere Behandlungspfade zur Auswahl stehen, können ergänzende Informationen wie Vitalwerte geprüft und von dem entwickelten Empfehlungssystem ein passender Behandlungspfad vorgeschlagen werden – dabei kann die Rettungskraft auch manuell wählen. Zusätzlich sind Behandlungspfade mit ähnlichen Maßnahmen eng miteinander vernetzt. Es findet eine kontinuierliche fundierte Neubewertung der Situation anhand von gespeicherten und neu aufgezeichneten Daten statt. Das KI-gestützte System erkennt Wahrscheinlichkeiten für andere Behandlungspfade, sodass der Rettungssanitäter vor Ort nach eigener Einschätzung schnell darauf reagieren kann.
Moderne technische Lösungen wie diese ermöglichen die Konstruktion einer Plattform, die sich dem Konzept des sogenannten ‚Digitalen Zwillings‘ annähert. Dabei handelt es sich um die virtuelle Repräsentation eines physischen Objekts oder Prozesses mit dem Ziel, ein reales Objekt oder System abzubilden. Mubaris Nadeem betrachtete den Digitalen Zwilling in seinem Vortrag außerdem als Plattform für die Wissensfusion zur Erkenntnisgewinnung, die es beispielsweise Rettungssanitätern schon auf dem Weg zum Notfall ermöglichen könnte, sich gezielt auf die bevorstehende Versorgung der Patient*innen vorzubereiten.
Die interdisziplinäre und intersektorale Zusammenarbeit ist ein Kernmerkmal der Forschungsgruppe „Digitale Praxis“. Diese fachliche Diversität spiegelt sich auch in den regelmäßig stattfindenden Vorträgen wider. Die Forschungsgruppe wird zusammen mit der DMGD in der neuen Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung „Zentrum für interdisziplinäre Gesundheitsforschung“ aufgehen.